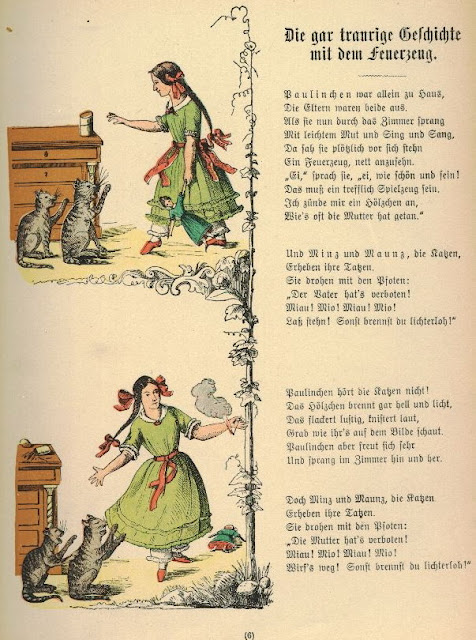Ideologie des Traditionalismus
und Sedisvakantismus
Die krypto-sedisvakantistische „Priesterbruderschaft
St. Pius X.“, im Volksmund „Piusbruderschaft“ genannt, nicht anders als ihre
Brüder im Geiste, die unmaskierten Sedisvakantisten jeglicher Färbung, führt
die zuspitzende Engführung der Theologie des 19. Jh, die ihren vorläufigen
Höhepunkt im Pontifikat Pius X. erreichte, fort. Mag uns auch die FSSPX gerne glauben machen, sie sei um Gottes Willen alles, nur nicht "sedisvakantistisch", so kann man bei nüchternem Blick nur feststellen, dass sie sich von den Sedisvakantisten durch ihre Inkonsequenz und Widersprüchlichkeit noch negativ abhebt.
Kennzeichen dieser Engführung waren
und sind ein päpstlicher Zentralismus und Monarchismus „mit der Brechstange“
und eine damit verbundene Gleichschaltung, die sich bis heute in der giftigen
Polemik gegen den das germanische Eigenkirchenrecht, den Gallikanismus und den Josephinismus
äußert. Im Volksglauben förderte und forderte Rom im 19. Jh unter Pius IX. die Idolisierung
des Papstes, pseudo-mystische Bewegungen und die Idealisierung „der“
Scholastik, vor allem die Thomas von Aquins.
Ein besonders verwirrendes Kapitel
dieser Ideologie ist die Instrumentalisierung der Marienverehrung für den
Papstkult und ansonsten eine herbe und herablassende Zurückdrängung und
Bevormundung der Frau in Kirche und Welt, dazu ein auffallender Antijudaismus,
der nicht selten auch antisemitische Ausmaße annimmt und die unbestreitbare
politische Option für den Faschismus.
Die im 19. Jahrhundert überschnappende
Dämonisierung der Freimauerei[1]
durch ultramontane Kräfte wird ohne jeden echten Beweis mitsamt allen längst
entlarvten „Fakes“ ebenso weitertradiert wie daraus abgeleitete
Verschwörungstheorien bezüglich einer „Neuen Weltordnung“, die man dem hintergründigen
Treiben der (angeblich jüdisch dominierten) „Hochfinanz“ und dem Zionismus
zuordnet, die wiederum von den USA aus „gesteuert“ würden.
In diesen Kreisen trifft man auf
ein ideologisch geklittertes Geschichtsbild der Kirche, aber nicht nur in
ihnen. Auch viele innerkirchliche konservative Kreise betreiben diesbezüglich
eine kaum erträgliche Schönfärberei. Zu nennen wäre hier etwa das vorgeblich
eine negative Kirchenkritik zurechtrückende, letztendlich aber doch idealisierende
Büchlein über das angeblich so "fortschrittliche" und "frauenfreundliche" Treiben der Inquisition. Die teilweise grauenvolle Praxis älterer
Zeiten, insbesondere durch Urteile der Inquisition und deren Überstellung der "Täter" an weltliche Gerichte, wird hier um einiger „Vorteile“ willen in einen
pittoresk-stilvollen Bilderbogen umgeprägt. Die vielen öffentlichen Verbrennungen von Menschen erhalten so einen heimeligen Glanz... [2]
Das ist Falschmünzerei und erinnert an die bekannte Verharmlosung der Verbrechen
Hitlers mit dem Hinweis darauf, dass er doch so viel modernisiert und die
Autobahnen gebaut habe. Auch der Hinweis darauf, man dürfe solche Dinge nicht mit den Augen unserer Zeit ansehen und beurteilen, muss angesichts der Schwere der verübten Taten abgewiesen werden. Ungerechte und grausame Hinrichtungen waren zu allen Zeiten ungerecht und grausam!
Der Zeitgenosse steht irritiert vor
diesem Chaos. Die Lebenszeit eines normalen Sterblichen reicht kaum mehr aus,
diesen Wirrwarr zu rezipieren und zu sichten, geschweige die Geister zu
unterschieden. Man bräuchte mindestens 300 Lebensjahre, um hier einigermaßen
klarzusehen.
Das vielgepriesene, ach so
vertrauenswürdige, ins Totale übersteigerte päpstliche Lehramt hat selbst noch
dem unbedarftesten Geist in den letzten 200 Jahren gezeigt, dass es in dieser
Überhöhung so vertrauenswürdig nicht sein kann, denn es widerspricht sich, hält
sich selbst nicht an seine „ordentlichen“ Feststellungen und stellt den
Gläubigen vor quälende Rätsel, von denen einige wenige Beispiele genannt werden
sollen:
- Wenn noch Benedikt XIV. bestimmte, dass es nicht erlaubt ist, jüdische Kinder gegen den Willen ihrer Eltern zu taufen[3], weil dies dem von Gott gesetzten Naturrecht entgegenstehe, die Kirche aber unter Pius IX. dennoch gerade das tat, sogar gegen internationalen Protest, und Pius IX. einen solchen Jungen, den man seinen verzweifelten Eltern im Kirchenstaat geraubt hatte, selbst und widerrechtlich „adoptierte“, um aus ihm einen katholischen Priester zu machen, eine Art „Trophäe“ kirchlicher Überlegenheit über das Judentum[4] – dann weiß man nicht, was man als Gläubiger von einem solchen Papsttum halten soll… Katholiken rasten aber regelmäßig aus, sobald Eltern, die etwa auf einem „Home-schooling“ beharren, weil sie die Sexualerziehung, die ihren Kindern aufgezwungen werde, dramatisieren, die Kinder entzogen werden und schreien Zeter und Mordio. Erinnert man sie daran, dass die Kirche genau dasselbe unter anderem Vorzeichen, doch auch gemacht hat, leugnen sie das ab oder verharmlosen es. Der Vatikan führte diese widerrechtliche Praxis jedoch selbst noch nach dem 2. Weltkrieg fort.[5]
- Oder – was ist davon zu halten, dass man mit dem Tridentinum die Unterdrückung der vielverzweigten Exemtionspraxis des Mittelalters, weil sie angeblich die Kirchenreform behindere, einleitete, dem entstehenden Jesuitenorden aber genau das, was man doch sonst beschneiden wollte, in einer fast grenzenlosen Weise zugestand, nämlich von den Diözesen unkontrolliertes Vagabundieren durch die gesamte Welt und alle damit verbundene Eigenmächtigkeit und Unterwanderung diözesaner Administration?
- Oder – wie kommt es, dass nach dem Tridentinum
Kastraten ihren großen Einzug in kirchliche Chöre hielten, allen voran in
der cappella sixtina, wo doch
die absichtliche Kastration von Knaben auch nach dem Kirchenrecht als
Verbrechen galt, ganz zu schweigen davon, dass man mit dem damit
verbundenen Konzept einer „übergeschlechtlichen“ oder „Engelsstimme“, mit
dieser Erzeugung eines „homo tertii
generis“ (eines Menschen des dritten Geschlechtes), wie man das auch
damals nannte, wohl dem heute so vehement und hysterisch von katholischer
Seite beklagten „Genderismus“ längst Vorläufermodelle geliefert hat, die
an Zynismus kaum zu überbieten waren?[6]
Und wie konnte es sein, dass die Kirche bis weit ins 19. Jh aufgrund der unkritischen Verhaftung an Thomas von Aquin lehrte, der Fötus im Mutterleib werde sukzessiv zur menschlichen Person, durchlaufe erst eine Pflanzen-, dann eine Tierseele und werde erst spät „menschlich“ beseelt? Und warum nahm man an, der männliche Fötus werde dabei schneller menschlich als der weibliche? Ja, ich weiß warum: weil Aristoteles das so gelehrt hat und Thomas dem Griechen mehr glaubte als der Hl. Schrift zu diesem Thema. Die Kirche tut heute angesichts der Abtreibungsproblematik so, als habe sie stets die Beseelung des Fötus mit der Zeugung gelehrt. Abtreibung war damals zwar nicht erlaubt nach dem Kirchenrecht, hatte aber noch nicht die Merkmale einer schweren Sünde. Ebenso hat die Kirche erst im 20. Jh allmählich und gegen vielen inneren Widerstand so etwas wie eine Gleichwürdigkeit der Geschlechter über die Lippen gebracht… Die Diskriminierung der Frau in der Kirche ging teilweise so weit, ihr sogar generell abzusprechen, ein Ebenbild Gottes zu sein. In den fraglichen Kreisen wird ein solches Denken unverkennbar aufrechterhalten. [7] - Wie ist es möglich, dass dieselben Leute, die dem Papst eine übermäßige Unfehlbarkeit zuschreiben (die allerdings nach dem Vaticanum I eine Irrlehre ist und bleibt) und dem Gläubigen im Geiste des Ignatius von Loyola eine Pflicht zum Kadavergehorsam aufnötigen, zugleich aber selbst keinerlei Achtung vor dem real existierenden Papst haben, sobald er ihrer Ideologie nicht folgt? Es ist möglich aufgrund der vielen Widersprüchlichkeiten päpstlicher Lehren – keine Frage! Warum aber wollte und will man nicht ein bescheideneres Modell päpstlicher Autorität akzeptieren? Tut der Papst, tut ein Konzil nicht, was diese Leute erwarten, wird er samt der Kirchenversammlung kurzerhand als ungültig oder heimlicher Freimaurer verleumdet – eine Strategie, die die Kirche im 19. und 20. Jh bereits sattsam und bis hin zur Lächerlichkeit vor allem in der sogenannten „pianischen Epoche“ durch ihre Päpste eingeübt hat.
Man könnte endlos fortfahren,
solche Fragen zu stellen…
Wen wundert es also, wenn zahlreiche
liebenswerte Menschen, einfache Gläubige, nicht selten sogar Personen, die nach
vielen postmodernen Wirrungen zurückkehren zur Kirche und glauben, nun seien
sie wieder „daheim“, in jähes Entsetzen verfallen, wenn sie die Zustände
erleben, die in der Kirche herrschen und denen einer Räuberhöhle gleichkommen,
auf die Verheißungen des Traditionalismus und Sedisvakantismus hereinfallen?
Sie lassen sich gutwillig
einspannen für den unlauteren Kampf dieser Leute, in aller Regel ohne eine blasse
Ahnung davon zu haben, wie verlogen und a-historisch all die Argumente dieser
Bewegungen sind und wie unvereinbar vor allem deren theologische Position, die
den Anspruch auf das angebliche „depositum
fidei“ erhebt, mit der realen dogmatischen Lehre ist, wenn man sie einmal
ausführlicher und nicht immer nur aus zweiter, traditionalistischer Hand,
studiert.
Spät geht einem ein Licht auf, dass
man bei den Traditionalisten und Sedisvakantisten nicht weniger als in der
sogenannten „Amtskirche“ für politische und häretische Zwecke missbraucht wird.
Geködert wird man dort über die Liturgie, die tatsächlich würdiger gefeiert
wird als weithin in der „normalen“ Kirche.
Die „Amtskirche“ erstickt indessen
auf ihre Weise an der inzwischen 1700 Jahre währenden Verquickung mit der
weltlichen Macht. Die Rolle des Outlaws will sie in ihrem Machtdrang nicht
wieder annehmen. Sie verrät in Europa lieber den gekreuzigten Herrn, als dass
sie mit ihm den Kreuzweg ginge. Sie will mitherrschen, mitreden, mitregieren,
gleich wer da am Ruder ist… Man muss aber erkennen, dass die Traditionalisten
und Sedisvakantisten auch nichts anderes wollen. Sie gehen nur etwas weiter und
wollen darüber hinaus noch mitbestimmen, wer
weltlich zu regieren hat, nämlich jemand, der aus ihrer Sicht berechenbar
und dirigierbar ist. Und das tun sie mit allen Bandagen, denn sie sind
historisch verstrickt in verschiedene faschistische Regime.
Monsignore Lefebvre war geistiger
Zögling der faschistischen „Action française“, die von Pius X. hofiert und
deren Gründer samt seinem Werk von diesem „Antimodernismus-Papst“ gesegnet
wurde, als er dessen Mutter eine Privataudienz gewährte.[8]
Pius XI. dagegen verurteilte ihre Irrlehren als unvereinbar mit dem
katholischen Glauben (auch das soll einer verstehen – diesen Widerspruch!). Pius
XII. nahm diese Verurteilung 1939 teilweise wieder zurück.
Lefebvre blieb Pius X. und dem
Gedankengut der „Action française“ treu. Auch interessierte ihn kaum, dass sein
Vater während der Vichy-Zeit in einem Konzentrationslager ermordet wurde, weil
er Widerständlern geholfen hatte.[9]
Lefebvre war und blieb Pétain-Anhänger und genehmigte sich als Bischof selbst
die öffentliche Wallfahrt an dessen Grab, an dem er ihn um Fürsprache bat für
das laizistische Frankreich – ein unerlaubter Akt, denn Pétains Seligsprechung
ist mehr als nur weit entfernt…[10]
Der durchschnittliche,
zeitgenössische und meist harmlose FSSPX- oder Sedisvakantisten-Anhänger hat in
aller Regel keinerlei Ahnung von all diesen Dingen und will sie auch nicht
haben. Er will sich träumend in würdigen Hl. Messen wohlfühlen können. Man kann
das natürlich verstehen, aber recht ist es nicht, denn diese Hl. Messen finden
nicht im luftleeren Raum statt, sondern im Rahmen eines häretischen und
schismatischen Vereins, der mit verdecktem Visier knallharte politische Ziele
verfolgt.
Noch schlimmer ist es um die Exponenten der FSSPX samt der
konkurrierenden Sedisvakantisten bestellt, denn sie wissen ganz genau, welchem
Ungeist sie sich verschreiben. Sehenden Auges führen sie die unselige
Verstrickung der Kirche mit antisemitischen, faschistischen und
reaktionär-ultramontanen „Traditionen“ fort, als wäre das immer ein Dogma
gewesen und sei nun leider aufgegeben worden. Zu dieser „Tradition“ gehört auch
ein spezifischer Erscheinungskult um Fatima, verschiedene Seherinnen des 18. und
19. Jh, die von der Kirche teilweise schon lange vor dem Konzil abgelehnt
wurden und die Selbstzuschreibung, der „heilige Rest“ des neuen Israel zu sein,
den Gott nun aus der „neurömischen Afterkirche“ herausgelöst habe. Der zweite
schismatische Bischof nach dem Vaticanum II, Bischof Ngo Dinh-Thuc, der nach
dem Konzil viele unerlaubte Priester- und Bischofsweihen durchgeführt hat – vor
dem Konzil war er während der Herrschaft seines Bruders Bischof von Hue, dem
Zentrum massiver Ausschreitungen des südvietnamesischen Herrscher-Clans gegen
wehrlose Zivilisten… Wie tief war er verstrickt in diese schweren Verbrechen und
wie tief hing er mit der unseligen, autokratischen Regierungszeit seines
Bruders Ngo Dinh-Diem samt des Ngo-Familien-Clans zusammen, die sich durch Zynismus und Gewalt auszeichnete und selbst durch die Ermordung des Präsidenten auf Betreiben der Amerikaner endete? Uns ist eine Einsicht
in die vietnamesischen Quellen aufgrund der Sprachbarrieren unmöglich, sofern
sie überhaupt möglich wäre.
Keiner der Ideologen dieser
Bewegungen stellt sich aber der Problematik, dass er faktisch protestantisch
und antipapistisch ist. Eine fiktive Papstschwärmerei, der gewissermaßen kein
realer Papst genügen kann, um sich daraufhin mehr oder weniger offen vom Papst
loszusagen, ist wertlos.
Der Weg zu der Situation, die wir
heute vorfinden in und um die Kirche, ist 2000 Jahre lang.
Je mehr man sich vertieft in die
Geschichte, desto klarer wird einem, was Jesus meinte damit, als er sagte, das
Himmelreich sei wie ein Acker, auf dem der Feind böse Saat aussäe. Gutes und
Böses ist in der Kirche so verwirrt und verwuchert ineinander, dass niemand das
mehr auseinanderdividiert bekommt. Jesus sagte daher, niemand solle das
(vermeintliche) Unkraut ausreißen, um
nicht den guten Weizen mit auszureißen. Mit dem ausgehenden Mittelalter
hielt sich die Kirche überhaupt nicht mehr an diese Warnung. Sie bespitzelte
die Gehirne und verbrannte auf dem Scheiterhaufen, wer nicht ihr Spiel – besser
gesagt das Spiel der Machthaber in ihr – spielte. Und noch das großspurige
Auftreten Pius X. missachtet Jesu Warnung aufs Gröbste. Dieser Mann bildete
sich ein, er könne das Böse mit der Wurzel ausreißen, und er tat es, indem er
sich selbst als „Vater par excellence“, dem
man blind gehorchen müsse, den
Gläubigen aufdrängte, den Klerikern einen zusätzlichen, ideologischen Treueeid abzwang, der die
Loyalität zu Christus gegen die zur Kirche ausspielte. Man erpresste in den Herzen eine totale Identifikation des Papstes mit Christus und gestand ihnen keinerlei Distanznahme für den Notfall mehr zu - ein Wahnsinn, der sich bitter gerächt hat! [11] Fortan
musste man sich vorspiegeln, dass Christus und alles, was in der Kirche
manövriert wurde, identisch sei. Ausweichmöglichkeiten waren scheinbar nicht
mehr gegeben. Es ist klar, dass diese ungesunde Strategie nicht dauerhaft gelingen
konnte.
Die Geister, die sich in einem
solchen Kesseltreiben als Agenten und Antreiber wohlfühlen, waren selbstverständlich
zutiefst verwirrt, als die Kirche oder das, was sie mit „der“ Kirche
identifizieren wollten, dennoch in sich zusammensank wie ein Gebilde aus Staub.
Der Chefkonstrukteur des vatikanischen Spitzelapparates („sodalitium pianum“) unter Pius X., Benigni, wandte sich
„frustriert“, weil Benedikt XV. und Pius XI. diesen unwürdigen Stil so nicht
weiterzuführen gedachten, schließlich ganz dem Faschismus zu und wurde
glühender Mussolini-Anhänger. Wen wundert es…
Anhänger der Traditionalisten und
Sedisvakantisten aber sollten sich klarmachen, wem sie folgen. Diese Bewegungen
sind keine Alternative zu den verheerenden Zuständen in der Kirche, sondern
deren polare Hypostase.
Es bleibt uns nichts anderes übrig,
als uns in Buße und Gebet der Mühe und Anforderung zu stellen, alle diese
einzelnen Fragestellungen genau zu durchdenken und zu erforschen und dabei weder
einer trägen Flucht in Schwärmereien noch einem Hang zur unlauteren Apologetik
zu verfallen.
© by Hanna Maria Jüngling
[1] Der
Höhepunkt dieser Dämonisierung, die von ultramontanen Kräften und v.a. der SJ
vorangetrieben wurden, geschah im sogenannten „Taxilschwindel“ und dem in
Trient inszenierten, päpstlich unterstützten „Anti-Freimaurer-Kongress“ 1896,
auf dem der Hochstapler Léo Taxil den informellen Vorsitz innehatte und die
Kirche mit einem gigantisch-inszenierten Schwindel an der Nase herumführte.
[2] Hans Conrad
Zander : Kurzgefasste Verteidigung der Heiligen Inquisition. Gütersloh
2007. Diese Thesen machte sich damals medienwirksam Gloria von Thurn und Taxis
zu eigen. Ein Interview mit ihr vom 14.5.2007 auf http://www.kath.net/news/16748,
abgerufen am 10.9.2016
[3]
Benedikt XIV. « Postremo mense » 1747, Kapitel 4 , vgl. DH 2552
[4]
« Weit über die jüdische Welt hinausgehende Empörung verursachte in
Bologna der Fall des jüdischen Jungen Edgardo Mortara (1852-1940), den eine bei
der Familie Mortara beschäftigte christliche Dienstmagd getauft hatte, weil sie
der Meinung war, das kränkliche Baby werde bald sterben. Mehrere Jahre später
erfuhr die Inquisition in Bologna, das noch zum Kirchenstaat gehörte, von
dieser Nottaufe und berichtete den Vorfall nach Rom, woraufhin der inzwischen
siebenjährige Edgardo mit Wissen des Papstes von der Polizei nach Rom entführt
wurde und dort in kirchlichen Internaten aufwuchs. Pius IX. selbst adoptierte
den Jungen, der bald die priesterliche Laufbahn einschlug. Beim Katholikentag
in Würzburg (1893) rühmte sich der Priester Edgardo Pio Mortara - den
Papstnamen hatte er inzwischen seinem Namen beigefügt - als "Schützling
Pius' IX.", der "auf eine ganz besondere Weise" sein Vater
geworden sei.“ Vgl. Georg Denzler: „Die Tradition bin ich.“ in: Deutsches
Allgemeines Sonntagsblatt 1. September 2000 Nr. 35/2000, online verfügbar: http://www.georgdenzler.de/Die_Tradition_bin_ich.html
(abgerufen am 10.9. 2016)
[5] „Nach
dem Krieg sei Papst Pius XII gebeten worden, jüdische Kinder, die in
katholischen Einrichtungen versteckt und deren Eltern ermordet worden waren, an
ihre Familien zurückzugeben. Der Vatikan sandte eine Antwort an den damaligen
Nuntius Roncalli in Paris, dem späteren Papst Johannes XXIII. Papst Pius XII
verfügte, jene Kinder, die ohne Wissen und Einverständnis ihrer ermordeten
Eltern getauft worden seien, nicht an ihre jüdischen Angehörigen auszuliefern.
So verlor das jüdische Volk weitere Mitglieder, obgleich sie den Massenmord
durch die Nazis überlebt hatten.“, nachzulesen in folgendem Bericht vom 15.
November 2008 auf n-tv http://www.n-tv.de/politik/politik_kommentare/Attacke-gegen-den-Vatikan-article35272.html
(10.9.2016)
[6] Paul
Münch : Homines tertii generis. Gesangskastraten in der Kulturgeschichte
Europas. In: Essener Unikate 14/2000, S. 58 ff
[7] Vgl.
Hanna Jüngling: Der Mantilla Wahn – Ist die Frau kein Ebenbild Gottes?
Blogartikel vom 26. Januar 2015 auf http://zeitschnur.blogspot.de/2015/01/der-katholische-zombie-ii-der-mantilla.html
[8] Vgl.
Ernst Nolte : Die Action française 1899 – 1944. Vierteljahrshefte für
Zeitgeschichte. Jahrgang 9 (1961), Heft 2, S. 124 ff, Verbindung der A.F. mit
der Kirche ab S. 144
[9] BERNARD
TISSIER DE MALLERAIS: Marcel Lefebvre. Die Biographie. Aus dem Französischen von Irmgard Haberstumpf. Sarto
Verlag, Stuttgart 2008. 760 Seiten, 29 Euro, Buchbesprechung „Der Unbewegliche“ vom 17. Mai
2010 in der Süddeutschen Zeitung, abgerufen am 10.9.2016 http://www.sueddeutsche.de/kultur/neue-biographie-marcel-lefebvre-der-unbewegliche-1.492668-2
[10] https://bibliothequedecombat.wordpress.com/2014/08/10/hommage-de-mgr-lefebvre-au-marechal-petain/, abgerufen am
4.12.2014: „C’est pourquoi, persuadés que vous pouvez désormais intercéder
pour nous auprès de Dieu, avec tous les saints et saintes de la patrie, nous
vous supplions de venir au secours de la France, que vous avez si bien servie,
pour qu’elle retrouve l’esprit dont vous l’avez animée au temps de la grande
épreuve. (…) Adresse au Maréchal Pétain par Mgr Lefebvre (13 avril 1987 à l’Ile
d’Yeu) »
(„Deshalb,
überzeugt davon, dass Sie von nun an bei Gott für uns eintreten können, mit
allen männlichen und weiblichen Heiligen des Vaterlandes, flehen wir Sie an,
zum Schutz Frankreichs einzutreten, dem Sie so gut gedient haben, damit es den
Geist wiederfinde, von dem Sie in der Zeit der großen Prüfung beseelt waren.“)
[11] Man
vergleiche die gehäuften polemischen und hämischen, teilweise martialischen
Wendungen in den entsprechenden Enzykliken Pius X., vor allem in „Pascendi“, die
selbstzuschreibende Nennung als „Vater par excellence“, dem man absoluten
Gehorsam schulde: Ansprache Pius X. vom
19. 11. 1912, zitiert nach Otto Weiß: Der Modernismus in Deutschland.
Regensburg 1995. S. 52